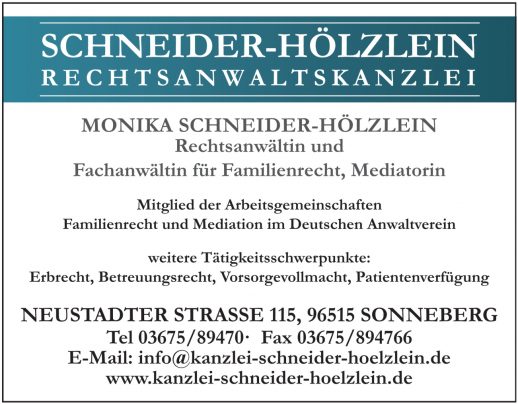Als elterliche Sorge bezeichnet man das Recht und die Pflicht, für ein Kind zu sorgen und rechtlich verbindliche Entscheidungen zu treffen. Sind die Eltern bei der Geburt miteinander verheiratet, so üben sie die elterliche Sorge gemeinsam aus. Sind die Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet, so hat die Mutter die alleinige elterliche Sorge, es sei denn, die Eltern geben eine sogenannte Sorgeerklärung ab. Diese Erklärung muss beurkundet werden. In der Regel erklären die Eltern gegenüber dem Jugendamt, dass sie auch als nicht verheiratete Eltern die elterliche Sorge für ihr Kind gemeinsam ausüben wollen. Hierüber wird dann eine Urkunde errichtet. Die Eltern können die Sorgeerklärung schon vor der Geburt abgeben.
Heiraten die Eltern eines Kindes, bei dem die Mutter die alleinige elterliche Sorge hat, so wird mit der Eheschließung die gemeinsame elterliche Sorge begründet.
Wenn die Kindesmutter die alleinige elterliche Sorge ausübt, der Kindesvater aber die gemeinsame elterliche Sorge möchte, so kann er dies durchsetzen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. In der Regel sollen auch die nicht verheirateten Eltern die Verantwortung für ihr Kind gemeinsam tragen.

Welchen Familiennamen hat mein Kind?
Sind die Eltern miteinander verheiratet, so erhält das Kind als Familiennamen den Ehenamen der Eltern. Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und haben sie die gemeinsame elterliche Sorge oder sind sie verheiratet und haben keinen gemeinsamen Ehenamen, so können sie wählen, wessen Namen das Kind trägt.
Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und hat die Mutter die alleinige elterliche Sorge, so trägt das Kind den Familiennamen, den die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt führt. Dies ist manchmal nicht gewollt, z. B. weil die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes noch einen Ehenamen führt. Das Kind bekäme dann den Namen des geschiedenen Ehemannes, der aber in keinerlei Beziehung mit dem Kind steht. Deswegen können die nichtehelichen Eltern, ohne die Alleinsorge zu verändern, den Namen des nichtsorgeberechtigten Elternteils, in unserem Beispiel den Namen des leiblichen Vaters, als Familiennamen des Kindes bestimmen.
Ändert sich der Familienname eines minderjährigen Kindes, so muss das Kind in die Namensänderung einwilligen, wenn es älter als 5 Jahre ist. Die Erklärungen zum Namen müssen teilweise öffentlich beglaubigt, also beurkundet werden. Hier helfen die Standesämter und die Jugendämter weiter. Für Namensänderungen gibt es Fristen, die im Einzelfall zu beachten sind.
Wie wirken sich Trennung und Scheidung auf das Kind rechtlich aus?
Haben Eltern die gemeinsame elterliche Sorge, sei es weil sie verheiratet sind oder weil sie eine Sorgeerklärung abgegeben haben, so bleibt es auch nach einer Trennung bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Insbesondere wird bei der Scheidung nicht von Amts wegen über die elterliche Sorge entschieden. Die Kinder werden also nicht einem Elternteil „zugesprochen“.
Schon aufgrund der räumlichen Trennung ist es jedoch schwierig, alle Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Deswegen sieht das Gesetz vor, dass das Elternteil, bei dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, die sogenannte Alltagssorge ausübt. Zur Alltagssorge gehören die Dinge des täglichen Lebens, die für das Kind nicht von erheblicher Bedeutung sind, wie z. B. Dinge des Schulalltags, Alltagsumgang mit Schulkameraden und Freunden oder auch gewöhnliche Arztbesuche bei leichteren Krankheiten. Die Beantragung von Personalpapieren, wie z. B. Reisepass, gehört zur Alltagssorge, die Reise selbst kann zu den Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung gehören, so dass zur Reise selbst die Zustimmung des anderen Elternteils erforderlich sein kann. Hier wird vieles im Einzelfall zu prüfen sein.
Lebt das Kind in gleichem Umfang bei beiden Elternteilen, wird also ein sogenanntes Wechselmodell praktiziert, dann dürfte es so sein, dass immer dasjenige Elternteil die Alltagssorge ausübt, bei dem das Kind gerade lebt. Hier ist noch vieles offen. Das Wechselmodell ist in Deutschland nicht der Regelfall, wird aber immer häufiger praktiziert.
In jedem Fall müssen die Eltern versuchen, sich bei Meinungsverschiedenheiten zu einigen. Wenn die Eltern Unterstützung benötigen, stehen die Familienberatungsstellen oder die Jugendämter als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Nur wenn es zum Wohl des Kindes erforderlich ist, kann die gemeinsame elterliche Sorge ganz oder in Teilen einem Elternteil allein übertragen werden. Die Messlatte liegt hier sehr hoch.
Leben die Eltern getrennt, so hat das Kind, unabhängig davon, ob die gemeinsame elterliche Sorge besteht oder nicht, das Recht des Umgangs mit dem anderen Elternteil. Gesetzliche Vorschriften, die das Maß des Umgangs in Tagen oder Wochen festlegen, gibt es nicht. Maßstab ist hier das Wohl des Kindes. Umgang ist immer so auszuüben, wie es dem Kind gut tut. Am häufigsten wird der 14-tägige Wochenendumgang und ein Ferienumgang praktiziert.
Auch der Unterhaltsanspruch des Kindes ändert sich mit der Trennung. Das Elternteil, bei dem das Kind gewöhnlich lebt, leistet seinen Unterhalt durch die tatsächliche Betreuung und Versorgung des Kindes. Das Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, leistet Barunterhalt, das sind Zahlungen, deren Höhe sich nach den Unterhaltstabellen richtet. In Bayern sind dies die Süddeutschen Leitlinien, in Thüringen ist dies die Thüringer Tabelle.
Leben die Eltern das Wechselmodell, so sind sie beide im Verhältnis ihrer Einkommen zum Barunterhalt verpflichtet. Die Zahlungen werden zwischen den Eltern ausgeglichen.
Leistet der barunterhaltspflichtige Elternteil keine Zahlungen, so kann der alleinerziehende Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen beim Jugendamt beantragen. Bisher waren nur Kinder bis zum 12 Lebensjahr für die Dauer von 72 Monaten bezugsberechtigt. Diese Beschränkungen sollen zum 01.07.2017 wegfallen. Das entsprechende Gesetz ist jedoch noch nicht verabschiedet.